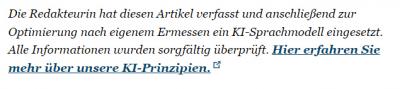Alltag im 18. Jh.
Anreden
Es wird oft gefragt,
wie wer wen anzureden habe. Bislang haben wir nur aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts brauchbare Angaben. Diese deuten an, daß es "früher" (also vor der Mitte des 18. Jh.) anders war, aber auf wann sich dieses "früher" bezieht und inwiefern es anders war, das erfahren wir nicht. Auf jeden Fall ist das Thema ebenso
Komplex wie das
Geflecht sozialer Beziehungen, so daß es auf diese Frage
keine einfache Antwort geben kann.
Heute glaubt man gemeinhin,
"Er" sei die herablassende, ja leicht verächliche Anrede eines Höhergestellten gegenüber jemand viel tiefer stehendem
("Hebe Er sich hinweg!"), z.B. eines Fürsten gegenüber einem Bauern. Tatsächlich wäre ein Bauer, der von einem Fürsten
geerzt wurde, verwirrt gewesen und hätte sich gefragt, ob der Fürst ihn
verkohlen will: Im 18. Jh. ist
"Er" (bzw. weiblich
"Sie") eine
höflichere Anrede als
"Ihr" und nur
eine Stufe unter dem
Plural-"Sie", die damals
höflichste Anrede.
Die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war
deutlich hierarchischer strukturiert als die heutige, und das spiegelte sich in den
Anredeformen. Im
deutschen Sprachraum waren
vier Anredeformen üblich:
Du (2. Person Singular),
Ihr (2. Person Plural),
Er/Sie (3. Person Singular) und
Sie (3. Person Plural, dem heutigen
Siezen entsprechend).
Anders als im heutigen Sprachgebrauch war die Anrede nicht nur eine Frage der
Intimität (Du) oder
Distanz (Sie), sondern vor allem des
sozialen Gefälles. Einem
Japaner dürfte das Prinzip vertrauter sein als einem heutigen
Deutsch sprechenden, denn im Japanischen
spricht man noch
heute mit einem
sozial Höhergestellten anders als mit einem
Tieferstehenden.
Einen winzigen Abklatsch davon kann man noch erahnen, wenn man bedenkt, daß Erwachsene Kinder duzen, die Kinder die Erwachsenen aber siezen: Es ist das soziale Gefälle das Alters. Während wir heute unterschiedslos alle Fremden siezen, mußte man im 18. Jh. unterscheiden, ob der Andere einen geringeren, den gleichen oder höheren Rang als man selbst hatte. Um die Sache noch komplizierter zu machen, kommt es nicht nur darauf an, wie groß der Abstand auf der sozialen Leiter ist, sondern auch auf den absoluten Status:
Während Gemeine, wenn sie verwandt oder gute Freunde sind, einander duzen, kennt man aus dem Briefen befreundeter Intellektueller oder verwandter Bürgerlicher das "Ihr", aber auch aus den Briefen der hochadeligen Liselotte von der Pfalz an ihre Verwandten, nicht nur an die jüngeren, sondern auch an ihre Tante, immerhin eine Kurfürstin.
Aber: Liselotte lebte zu Anfang des Jahrhunderts, und es gibt Hinweise darauf (siehe Gottsched in der Tabelle unten), daß das Ihr früher im Jahrhundert noch einen höheren Rang hatte als später. Es sieht so aus, als ob die Anreden im Verlauf des Jahrhunderts immer höflicher wurden, d.h. wer um 1700 noch geihrzt wurde, wurde gegen Ende des Jahrhunderts eher geerzt. Siehe Journal des Luxus und der Moden*** in der Tabelle unten: Der ehedem geduzte Knecht wird nun (am Ende des Jahrhunderts) geihrzt und zuweilen wird dem Bedienten, dem eigentlich nur das Ihr zusteht, die Ehre zuteil, geerzt zu werden. Eine ähnliche "Höherentwicklung" kennt man vom wib (Weib), das im Mittelalter noch eine neutrale Bezeichnung für einen weiblichen Homo Sapiens war, während frouwe (Frau) eine Adlige auszeichnete.
Es gibt also vier Kriterien, die bei der Wahl der Andrede zu bedenken sind:
• Welchen sozialen Status haben die Beteiligten absolut?
• Wie groß ist das soziale Gefälle zwischen ihnen?
• Wissen die Beteiligten, wie groß das Gefälle ist? Femde können nur nach äußeren Kriterien wie Auftreten, Sprache und Kleidung urteilen,
während langjährige Bekannte auch die Geburts-Herkunft kennen.
• Wann im Jahrhundert treffen sie sich?
Für die Bestimmung der
korrekten Anrede ist es also unabdingbar, die
Kriterien zu kennen, nach denen Personen in der sozialen Hierarchie verortet wurden:
Elternhaus, Bildung, Beruf, Einkommen. Und, leider... bei
Frauen waren es
Elternhaus und
Beruf/Einkommen des
Vaters bzw. später des
Ehemannes.
Da ich hier nicht auf die
multidimensionalen Komplexitäten sozialer Schichtung eingehen kann, beschränke ich mich auf
allgemeine Regeln.
Plural und Indirektion
Eine
Plural-Anrede gilt als
höflicher als eine
Singular-Anrede. Daher ist
"Ihr" höflicher als
"Du". Noch höflicher ist es, jemanden
nicht direkt anzusprechen. In asiatischen Kulturen wird das noch heute sehr deutlich: Egal, ob es um die direkte Anrede oder um direkten Augenkontakt geht, beide stellen
eine Durchbrechung der
Individualdistanz und mithin einen
Einbruch in die
persönliche Sphäre dar.
Im
Japanischen z.B. sagt man, wenn man besonders höflich sein will, nicht
"Du gehst" sondern man benutzt die Passivform,
"Du wirst gegangen". Das erscheint einem Deutsch-Muttersprachler in der Übersetzung seltsam, aber der wichtige Aspekt ist: Das Passiv wirkt nicht direkt auf den Gesprächspartner, sondern macht einen Umweg, und darin besteht die Höflichkeit. Ein ähnliches Prinzip wirkt im Deutschen, nur daß uns das heute
nicht mehr so
klar ist:
Jemanden in der
3. Person anzusprechen bedeutet eigentlich, ihn eben
nicht anzusprechen, sondern
quasi mit einer
imaginären anderen Person
über ihn zu sprechen. Mithin ist
"Geht es Ihm gut?" höflicher als
"Geht es Euch gut?". Daraus ergibt sich folgende
Hierarchie der
Höflichkeitsstufen:
2. Pers. sg. (Du) -> 2. Pers. pl. (Ihr) -> 3. Pers. sg. (Sie/Er) -> 3. Pers. pl. (Sie)
Wer
extrem höflich sein will, z.B. einem Fürsten gegenüber, spricht den Anderen nicht einmal in der
dritten Person an, sondern baut eine
weitere Stufe der
Indirektion ein. In diesem Fall kommen Worte wie
"dero" oder
"derselbe" ins Spiel, die eine besondere, noch indirektere Form der dritten Person darstellen:
"Darf ich bei Dero Gnaden um Audienz ersuchen?"
Sozialer Abstand
Es hilft, wenn man sich die
Hierarchie der Anredeformen als
Leiter vorstellt:
Ganz oben ist das fürstliche
"dero", darunter das
3. pers. plural "Sie", darunter
"Er/Sie", dann
"Ihr" und schließlich
"Du".
Auf dieser Leiter sitzen die beteiligten Personen. Je
weiter unten beide Beteiligte sitzen, desto eher werden sie
einander duzen, wenn sie auf der gleichen Sprosse sitzen. Sitzt eine davon eine Sprosse
höher, wird die untere Person (z.B. Magd) die höhere (Bäuerin)
ihrzen, die höhere die untere
duzen.
Eine weitere Sprosse
höher wird der Bauer den Wirt
erzen, der Wirt den Bauern
ihrzen, und dessen Magd
duzen. Wieder eine Stufe
höher wird der Wirt den Handwerksmeister
erzen, der Meister den Wirt
ihrzen und den Bauern
duzen. Der Handwerksmeister wird andere Meister
erzen, den Pfarrer und den Richter
siezen, den Wirt
ihrzen und den Bauern und seine Magd
duzen. Und immer so weiter die Leiter hinauf, bis der Dichter den Denker
siezt, es sei denn, die sind Freunde - dann
ihrzen sie einander - oder richtig gute Freunde, dann
duzen sie einander. Der Dichter wird, um die Extreme ins spiel zu bringen, vermutlich die Bauernmagd
duzen und sie ihn
siezen.
Da der Artikel aus dem
Journal des Luxus und der Moden, der dies alles ausfühlich behandelt, inzwischen
online abrufbar ist, spare ich mir detailliertere Ausführungen und lege jedem, der es genauer wissen möchte, die Lektüre desselben ans Herz.
...
[Links nur für registrierte Nutzer]







 Mit Zitat antworten
Mit Zitat antworten





 Gott mit uns
Gott mit uns