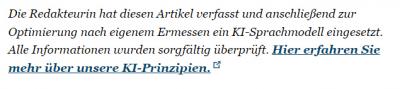Zitat von
amendment

Puschkin, Tolstoi und Tschechow: Bibliotheken entsorgen tonnenweise russische Literatur
Auf dem Index der Lehrpläne von Schulen stehen neben Tolstoi die Namen von Alexander Puschkin, Anton Tschechow oder Anna Achmatowa. Auch Bibliotheken entsorgen tonnenweise russische Literatur, weil laut Anordnung des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik Propagandaliteratur aus ukrainischen Bibliotheken zu entfernen sei. Wobei der Begriff, was als Propaganda gilt, offenbar sehr weit gefasst wird. Allein im vorigen Jahr haben die Bibliotheken 19 Millionen Bücher aus ihren Beständen vernichtet.
Das rigorose Vorgehen – so erklären es ukrainische Autorinnen und Autoren – sei auch eine Antwort auf eine jahrzehntelange Russifizierung und auf die Diskriminierung der ukrainischen Sprache!
An Michail Bulgakows Kiewer Wohnhaus soll die Gedenktafel entfernt worden sein. Im Zuge der Entrussifizierung werde bereits gefordert, die Skulptur des Autors von „Der Meister und Margarita“ irgendwann zu beseitigen. Auch das gehört in die Liste der Kriegsverluste, wenngleich marginal zu den noch ungezählten Kriegstoten.
aus: [Links nur für registrierte Nutzer]
Dazu sage ich: Es herrscht in der Ukraine nun mal Krieg und die Sitten werden rauer...
Aber wie "schmeckt" dir das hier:
Zensur in Russland: Die verbotenen Bücher
In Russland verschwindet Literatur aus den Läden, kommt in „Sonderlager“ oder wird getarnt verkauft. Der Grad der Absurdität nimmt zu. Null. Null. Null. Und noch eine, noch eine, noch eine. Alles voller Nullen, von Seite eins bis Seite neun, die die Verkäuferin im Moskauer Buchladen „Dom knigi“ (Haus des Buches) am Rechner des Buchbestandes aufmacht. Es ist die größte Buchhandlung Moskaus an der Prachtmeile Neuer Arbat mit Häusern in Buchform unweit des Kremls. Einst waren hier gleich mehrere Regale mit Büchern von
[Links nur für registrierte Nutzer], dieser klarsichtigen Grande Dame der russischen Literatur, ausgefüllt.
Ulitzkaja, die kennt jede und jeder in Russland. Irgendein Titel ihres großen Werkes ist ihnen mindestens einmal über den Weg gehuscht, „Sonetschka“, „Medeas Kinder“, „Daniel Stein“, „Das grüne Zelt“, „Jakobsleiter“. Und nicht nur in Russland. Auch in Deutschland, wo die 81-Jährige seit März 2022 im Exil lebt, weil ihre Söhne befanden, die Mutter könne aufgrund ihrer Kritik am Putin-Regime nicht länger im Moskauer Zuhause bleiben, ist sie keine Unbekannte. „Aber natürlich haben wir Ulitzkaja da, das ist nicht möglich, dass kein einziges Buch von ihr in irgendeinem Regal steht“, sagt die junge Verkäuferin im Dom knigi und schaut mehrere Minuten auf den Ladencomputer. „Kann nicht sein. Kann nicht sein“, murmelt sie vor den zahlreichen Nullen in Rot vor sich.
Die Realität in Russland zeigt seit Monaten, ja seit Jahren, was alles sein kann auf dem heimischen Buchmarkt: Bücher verschwinden aus den Läden, sie kommen in „Sonderlager“ von Bibliotheken und werden mit dem sogenannten „Status 5“ versehen, also zu Büchern, die nicht an die Le*se*r*in*nen ausgegeben werden dürfen. Die Menschen überlegen sich zweimal, welches Buch sie in der Metro aufschlagen, welches Buch sie über die Grenze mitnehmen. Was ist erlaubt? Was schon gefährlich? Murakami? Rowling? Yanagihara? Sorokin? Limonow? Jachina? „Hier“, sagt so manche Bibliothekarin im Land, „hier ist das von Ihnen angeforderte Buch von Dmitri Bykow. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie hiermit das Buch eines,ausländischen Agenten' erhalten.“
In manchen Büchereien ist nicht einmal das möglich, da Bykows Bücher, diese oft humorvoll parodierenden Romane und Gedichte, aus dem Verkehr gezogen wurden.
Es kursieren Listen mit verbotenen Büchern, aufgestellt von Buch*händ*le*r*in*nen und Versandhäusern aus vorauseilendem Gehorsam. Jedes Mal, wenn eine solche Liste – mit in- und ausländischen Au*to*r*in*nen – auftaucht, beeilt sich eine russische Behörde mitzuteilen, es gebe gar keine solche Liste. Aber weiß man’s? Niemandem ist wirklich klar, was verboten ist, und doch meinen alle zu wissen, was im Verborgenen bleiben sollte. Jede und jeder hat auf die eigene Weise Angst: denunziert und bestraft zu werden, sich zu rechtfertigen, als Feind des eigenen Landes abgestempelt zu sein. Bücher sind längst zum Thermometer geworden, um den Grad der Absurdität im Land zu messen.
Selbstzensur wird als noch schlimmer empfunden
Es ist eine Zwischenwelt, in der Anwälte die Gefahr von Worten prüfen, in der Metaphern die Wirklichkeit beschreiben und doch so viele Lücken bleiben. Die Menschen, vor allem die Älteren, kennen das alles, sie können bestens zwischen den Zeilen lesen, sie hatten das zu Sowjetzeiten jahrzehntelang geübt. Sie haben mit Tamisdat und [Links nur für registrierte Nutzer] gelebt, dem „Dortverlag“ und dem „Selbstverlag“. Büchern also, die von sowjetischen Au*to*r*in*nen geschrieben, aber im Westen gedruckt wurden, und Büchern, die meist von der Sowjetunion verboten, auf inoffiziellen Kanälen jedoch verbreitet wurden – indem die Menschen sie einfach mit der Hand oder der Schreibmaschine abschrieben oder sonstwie vervielfältigten. Und somit unter großen Risiken in Umlauf brachten.
Tamisdat ist längst wieder Alltag in Russland. Bücher von russischen Au*to*r*in*nen werden seit 2022, der russischen Invasion in der Ukraine und Russlands Kampf gegen „Feinde im Innern“, im Ausland gedruckt. Die Biografie des im Straflager umgekommenen russischen Oppositionspolitikers [Links nur für registrierte Nutzer] etwa erschien auch auf Russisch im Westen. In Russland ist das Buch verboten wie etliche andere *Bücher von russischen Journalist*innen, Politolog*innen, Schriftsteller*innen, die teils bis vor wenigen Jahren mit staatlichen Prämien geschmückt wurden.
aus: [Links nur für registrierte Nutzer]