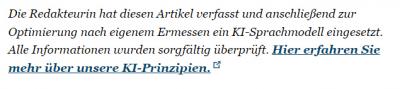Zeitgeschichte-Online | von Stephan Horn | 18. August 2023
DER FLUG VON MATHIAS RUST NACH MOSKAU IM JAHR 1987
Performanz der Selbstermächtigung?
Am
28. Mai 1987 flog der 19-jährige westdeutsche Hobbypilot
Mathias Rust ohne Vorankündigung über den „Eisernen Vorhang“. Er landete mit einer gecharterten Cessna 172P „Skyhawk II“ nahe des
Roten Platzes in
Moskau. Bis heute bleibt sein Überraschungscoup rätselhaft. Was wollte Rust mit dieser Tat bezwecken? Warum hielt ihn die sowjetische Luftverteidigung nicht auf? Im Westen entwickelte sich der Flug von Mathias Rust zu einem langlebigen Medienereignis.
Ihm selbst brachte die Aktion 432 Tage Haft im Moskauer Lefortowo-Gefängnis ein. Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow nahm die Versäumnisse der eigenen Flugabwehr zum Anlass, einige seiner Kritiker im Militär abzusetzen.
Der Flug von Mathias Rust trieb damit nicht zuletzt Gorbatschows Politik der „Perestroika“ (Umgestaltung) in den sowjetischen Streitkräften voran. Trotz der tiefgreifenden innenpolitischen Folgen dieser Aktion liegt bis heute keine umfassende wissenschaftliche Studie darüber vor. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive trägt der Flug von Matthias Rust Züge einer Performanz der Selbstermächtigung.
Tauwetter in der Sowjetunion?
Der Flug von Mathias Rust ereignete sich in der Spätphase des Kalten Krieges. Mit dem neuen Parteichef Michail Gorbatschow zeichneten sich Mitte der 1980er Jahre politische Reformen in der Sowjetunion ab. Wie es der Zufall wollte, verkündete Gorbatschow einen Tag nach der Landung von Rust auf einer Tagung in Ost-Berlin die neue Defensivstrategie der Warschauer Vertragsorganisation.[1] Im Falle der Defensivmaßnahmen der sowjetischen Luftverteidigung hatten einige Jahre zuvor mehrere Zwischenfälle dazu geführt, dass der Beschuss ziviler Maschinen durch die Flugabwehr verboten wurde. Im Frühjahr 1978 zwang der Jagdflieger Alexander Bosow eine südkoreanische Boeing 707, die sich in den sowjetischen Luftraum verirrt hatte, zur Landung. Zwei Passagiere starben. Danach kam es zu einer Dezentralisierung der Kommandostrukturen der sowjetischen Flugabwehr, wovon im Folgenden noch die Rede sein wird. Im Herbst 1983 schoss der sowjetische Jagdflieger Gennadij Nikolajewitsch Osipowitsch ebenfalls eine südkoreanische Boeing 747 ab, die sich in den sowjetischen Luftraum verirrt hatte, dabei starben 269 Menschen. Die sowjetische Führung untersagte daraufhin jedes Feuer auf zivile Maschinen.[2]
Der Ablauf des Fluges
Mathias Rust flog
nicht auf
direktem Wege von der
Bundesrepublik Deutschland in die
Sowjetunion. Er nahm mehrere Wochen Urlaub und verband seine Aktion mit einer touristischen Flugreise nach
Island und
Finnland. Von
Helsinki aus startete Rust am Morgen des
28. Mai 1987 seinen Flug Richtung Moskau. Kurz nachdem er über dem heutigen
Estland in den sowjetischen Luftraum eingedrungen war, identifizierte ihn der Pilot einer aufgestiegenen MiG-23 irrtümlich als
gewöhnlichen Sportflieger. Es folgten weitere Fehldeutungen und Pannen der sowjetischen Flugabwehr und Flugsicherung, so dass Rust unbehelligt am Abend auf der Großen
Moskwa-Brücke landen konnte. Er hatte den Roten Platz zuvor mehrfach überflogen, sich schließlich wegen der Menschenansammlungen gegen ein dortiges Aufsetzen entschieden.
Im Nachgang der Untersuchungen zum Fall Rust schrieb Gorbatschow in einem persönlichen Brief an den Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker: „Doch entsprechend den bestehenden Weisungen […] waren die Truppen der Luftverteidigung verpflichtet, den Flug des Luftraumverletzers ohne Einsatz von Kampfmitteln zu unterbinden.“[3] Gorbatschow sparte nicht mit Kritik an der Flugabwehr: „Die Dienststellen der Luftverteidigung haben jedoch in dieser Situation elementare Sorglosigkeit, Unbeweglichkeit und Unorganisiertheit an den Tag gelegt. Das Zusammenwirken der Truppen war nicht gewährleistet, Hubschrauber oder leichte Flugzeuge wurden nicht rechtzeitig eingesetzt, und die Überwachungsmittel stellten die Verfolgung des Ziels in der Annahme ein, daß es im Gebiet des Ilmen-Sees verschwunden sei.“[4]
Das Medienereignis und seine Konjunkturen
Während in der DDR die Berichterstattung über den Flug von Mathias Rust zurückhaltend blieb, entwickelte sich in der Bundesrepublik Deutschland die spektakuläre Landung vor dem Kreml zu einem Medienereignis. Drei Phasen lassen sich unterscheiden: Zunächst lag der Fokus der westlichen Medien auf dem vermeintlichen „Husarenstück“, mit dem Rust die sowjetische Luftverteidigung düpiert hätte.
„Die tollkühne Landung auf dem Roten Platz. 19jähriger Deutscher: Ich wollte mal mit den Russen reden“,
titelte die
BILD, damals schon die auflagenstärkste Tageszeitung der Bundesrepublik Deutschland.[5] Auch das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL kolportierte nach der Landung das Bild des tollkühnen Fliegers: „Nicht nur in der Luft, auch zu Lande war die Sowjetmacht zunächst hilflos gegen den frechen Sportsmann: Er konnte in rotem Overall seiner Kanzel entsteigen, sozusagen im Angesicht des toten Lenin auch noch Autogramme verteilen, wurde behauptet.“[6] In einer zweiten Phase entwickelte sich die Erzählung vom weltfremden Muttersöhnchen, das fahrlässig den Frieden gefährdet hätte. Die Illustrierte Stern hatte einen Exklusiv-Vertrag mit Rust abgeschlossen, und insbesondere Sternreporter Erich Follath prägte nach der Freilassung das Narrativ vom labilen Spießbürger: „Schon rein äußerlich stellt man sich einen tollkühnen Draufgänger anders vor!“ heißt es in einem Exklusivbeitrag nach der Haftentlassung.[7] Schließlich formierte sich das Bild des gewieften Medienakteurs, den Ruhmsucht und Geldgier angetrieben hätten. „Seine weiche Landung“ stand auf einer Titelseite der Illustrierten Quick von 1988. Die Fotomontage zeigt Mathias Rust in der ikonischen roten Fliegerkombi, wie er freudestrahlend auf einem Haufen Banknoten tanzt. Betont wurde die vermeintlich gewinnbringende Seite des Fluges von Mathias Rust: „Kreml-Flieger Rust macht sich rar und teuer. Um an seiner Geschichte besser verdienen zu können.“[8]
Mathias Rust und seine politische Mission
„Ich hatte ein politisches Motiv“, erklärte Mathias Rust dem ins Untersuchungsgefängnis geeilten Vertreter der bundesdeutschen Botschaft in Moskau.[9] Im Gepäck trug Rust ein
selbstverfasstes Manifest, in dem er ein utopisches Traumland namens „Lagonia“ beschrieb. Mit diesem Gesellschaftsentwurf versuchte er die
Vorteile beider Systeme in Ost und West in einer
Idealgesellschaft zu vereinen.
Dazu zählten das Recht auf Arbeit und Wohnung, basisdemokratische Elemente nach dem Vorbild der Schweiz und die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien.
...
[Links nur für registrierte Nutzer]